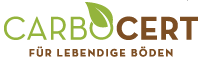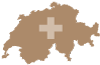Wie kann Humusaufbau gelingen?
CarboCert schreibt seinen Landwirten kein bestimmtes Bewirtschaftungsschema vor. Beim Humusaufbau gibt es keinen Königsweg, denn dafür, sind die geologischen, klimatischen und produktionstechnischen Voraussetzungen der landwirtschaftlichen Betriebe viel zu verschieden. Jedoch haben sich im Laufe der Zeit die u.g. Punkte für den erfolgreichen Humusaufbau bewährt.
Entlastung des Bodens mechanisch wie auch chemisch
Der Boden ist ein Ökosystem, das fast so alt ist wie das Leben selbst auf diesem Planeten. Dieses Ökosystem hat sich selbst, durch sich gegenseitig fördernde Symbiosen, zu einem hoch effizienten System entwickelt. Durch den Bodeneingriff des Menschen wurde dieses System gestört. Schritt für Schritt sollten durch die Wiederherstellung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit diese Eingriffe reduziert werden.

Herstellung von Nährstoffgleichgewichten im Boden
Nährstoffe werden bei der Analyse oft nur quantitativ und nicht in der Verhältnismäßigkeit zueinander betrachtet. Aber nur so können Nährstoffungleichgewichte entstehen und bestimmten Nährstoffe werden wieder für die Pflanzen verfügbar. Dies ist aber nur eine Auswirkung von Nährstoffungleichgewichten im Boden. Nährstoffungleichgewichte können durch eine spezielle KAK Analyse nach der Methode Albrecht ermittelt werden.
Möglichst ständige Bedeckung des Bodens
Der Boden sollte möglichst immer mit lebendem und oder toten Pflanzen bedeckt sein. Die Klimatisch bedingten Einflüsse auf unsere Böden nehmen in ihren Extremen ständig zu. Starkniederschlagsereignisse, starke Winde und Stürme sowie Dürren verursachen den Verlust von unersetzbarem fruchtbarem Oberboden. Der Boden sollte aus diesem Grund vor diesen Einflüssen ständig geschützt sein. Von Natur aus sind Böden immer bedeckt.
Erzeugung von Vielfalt und Artenreichtum
Eine Zwischenfrucht, die nur eine Art enthält, setzt die Monokultur der Hauptfrucht fort. Funktionierende Ökosysteme bestehen immer aus Vielfalt. Ein humoser, natürlich fruchtbarer Boden ist ein funktionierendes Ökosystem. Das nur durch die Vielfalt über dem Boden entstehen kann. Das bedeutet z.B., dass eine Untersaat oder Zwischenfrucht mind. 15 Arten haben muss. Nur so entstehen Habitate für darauf aufbauende Ökosysteme, wie das, der Insekten und Vögel.
Durchwurzelung des Bodens mit lebenden Wurzeln
Durch eine möglichst ständige Durchwurzelung mit biodiversitären Wurzel auf allen erreichbaren Stockwerken des Bodens wird der maximale Eintrag von Bodenkohlenstoff in den Boden gewährleistet. Der Bodenmotor kann nur laufen, wenn oberirdisch eine begrünte Pflanze steht, die Photosynthese betreibt. Nur so, gelangt die Primärenergie der Sonne über die Wurzeln in den Boden. Dort treibt diese Energie den Austausch von Nährstoffen zwischen allen Beteiligten auf allen Bodenstockwerken an.
Integration von Tieren
Tiere sind ein wichtiger Bestandteil im System des natürlichen Nährstoffkreislaufes der Natur. Die natürlichen Hinterlassenschaften von Kühen enthalten z.B. ca. 50 % an Bakterien, die im Boden vorkommen. Kühe tragen somit zur positiven Beimpfung mit Bakterien bei. Das ist nur ein Grund für die mögliche Integration von Tieren in das landwirtschaftliche System.
Weitergehende Informationen dazu: https://www.oekolandbau.nrw.de/fachinfo/tierhaltung/gruenland-futterbau/2020/mob-grazing-eine-alternative-weidestrategie/
Fäulnisprodukte im landwirtschaftlichen Nährstoffkreislauf vermeiden
Durch die arbeitswirtschaftlichen Vorteile fallen in der Tierhaltung anaerobe Düngeprodukte an. Alles was sehr stark riecht und unangenehm für uns Menschen ist, ist auch unangenehm für die Bodenbiologie. Durch den langjährigen Einsatz solcher Produkte verändert sich die Zusammensetzung der Bakterien sowie das Bakterien-Pilzverhältnis im Boden negativ. Dies wiederum führt zu Nährstoffverlusten mit all seinen negativen Auswirkungen, wie z.B. ein nitratbelastetes Grundwasser.
Fäulnisprodukte sollten aus diesem Grund immer aufbereitet werden. An dieser Stelle können positive Zuschlagsstoffe wie z.B. Gesteinsmehle, Pflanzenkohle, Effektive Mikroorganismen, Heu-Tee usw. Abhilfe schaffen. Auch reife Komposte stellen eine wertvolle Nahrungs- und Nährstoffquelle für die Bodenbiologie dar.
Organisch statt Mineralisch Düngen
Fast alle Landwirte haben in ihrer Ausbidung vom Liebigschen Minimum Gesetz gehört. Es zeigt, wie Ressourcen-Limitierung das Pflanzenwachstum einschränkt. Pflanzen benötigen essenziellen Nährelemente, um gesund wachsen zu können. Mangelt es an einem Elemente, hemmt es das Wachstum der Pflanze, selbst dann, wenn alle anderne Nähstoffe im Überfluss vorhanden sind. Unten im Bild werden die einzelenen Nährelemente als verschiedene lange Dauben dargestellt. Es kann somit nie mehr Wasser in dem Fass gehalten werden, als die kürzeste Daube lang ist. Die jeweils knappste Ressource schränkt das Pflanzenwachstum ein und wird deshalb als Minimumfaktor bezeichnet.Daraus könnte man schließen, dass für das schnelle und gesunde Wachstum der Pflanze nur die erforderlichen Nährstoffe in ausreichender Menge bereitstehen müssten.
Wie wir heute wissen, vernachlässigt dieses Modell komplett die Bodengesundheit und den Boden im Allgemeinen mit seinen unzähligen Kleinstlebewesen, Organismen und in Wechselwirkung stehenden Systemen.

Die International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD), die ebenfalls den Weltagrarbericht verfasst, warnte unmissverständlich 2009 zu dem Thema: "Pestizide und Düngemittel wirken sich weltweit negativ auf die Qualität von Luft, Böden und Wasserquellen aus."- Denn der Boden als lebendiger Organismus bevorzugt komplexe, organische Nährstoffe, wie Kompost und Stallmist, anstatt einfache Darreichungsformen, wie z.B. Kunstdünger.
Am Beispiel der Vergangenheit zeigt sich, wie früher Nährstoffkreisläufe geschlossen wurden. Damals wurden die Exkremente von Tieren und Menschen als wertvolles Mittel für die Bodengesundheit genutzt. Mit der Zugabe von Holzspänen oder Pflanzenkohle ergibt Sie nach einer Zeit ein nährstoffreicher und organischer Kompost, der auf das Feld ausgebracht werden konnte. Dieser Kompost beinhaltet außerdem die Nährstoffe und Mineralien, die dem Boden zuvor bei der Produktion der Nahrungsmitteln entnommen worden ist.